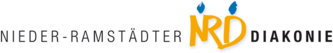Die Revolution des Grießbrei-Kochens
20.07.2015 | Werner Bloßfeld
Autor
Werner Bloßfeld

Text: Werner Bloßfeld
Ich kam 1973 als gelernter Bäcker in die Heime und wurde vom Direktor per Handschlag eingestellt. Angefangen habe ich als Helfer im Pflegedienst im Männerhaus. Während meiner Ausbildung zum Heilerziehungspflegehelfer 1974/75 lernte ich verschiedene Häuser und Gruppen kennen. Nach der Ausbildung musste ich erst einmal in den Sockel. Im Sockel des Männerhauses lebten Mitte der 70er-Jahre über 30 Personen. Bis zu acht Männer waren in einem Zimmer zusammen. Die Metallbetten hatten Plastikmatratzen, die immer schmutzig waren. Im Frühdienst arbeiteten wir wie am Fließband: Einer holte die Männer aus dem Bett, einer hat sie gewaschen, einer zog sie an, dann gab es Frühstück. Die schmutzigen Stoffwindeln mussten ausgewaschen werden. Wenn man das mit kaltem Wasser machte, dann stank es weniger.
Eine Geschichtswerkstatt während der Arbeit an diesem Buch hat Erinnerungen in mir geweckt, die nicht angenehm waren. Heute weiß ich, ich war ein Teil des Heime-Apparates, habe mich instrumentalisieren lassen: Die Stationsleiter hatten immer recht, und man musste tun, was gesagt wurde. Um alles zu schaffen, passte man sich an. Am erfolgreichsten war man, wenn man nichts kritisierte und auch nicht versuchte, einen Kollegen wegen seiner Umgangsweisen anzusprechen. So machte auch ich das Vorgelebte mit. Wenn kein Bewohner auffiel, dann war die gemachte Arbeit gut: sauber, satt, am liebsten leise und unsichtbar! Die Heime Mitte der 70er-Jahre würde ich so beschreiben: Stärkere hatten die Macht über Schwächere, Mitarbeiter konnten ihre Aggressionen auf der Station ausleben. Mit den „schwierigen“ Bewohnern wurde oft roh und gewalttätig umgegangen. Sie wurden geschubst, getreten, geschlagen und sich selbst überlassen. Einzelne wurden fixiert, manche haben in ihre Strümpfe gekotet und daran gelutscht. Natürlich hatten diese Zustände auch damit zu tun, dass es eine Masse an Arbeit und zu wenig Personal gab.
Ein Beitrag aus:
"Aussortiert – Leben außerhalb der Gesellschaft"

Die Nieder-Ramstädter
Heime nach 1945
Herausgeber Stiftung
Nieder-Ramstädter Diakonie
Mühltal 2014, 24 Euro,
ISBN: 978-3000447112
Das Buch kann auch über unser Bestellformular bestellt werden:
ie Diakone haben die Augen vor diesen Tatsachen verschlossen und so das System stabilisiert. Neben der alltäglichen, auch strukturellen Gewalt gab es die „Chemie für die Seele“: Der Umgang mit Medikamenten war damals lockerer als heute, unter Umständen wurde einem Menschen, der auffällig wurde, auch durch die Kleider hindurch eine Spritze in den Körper gerammt.
Undenkbar war es, mit den Menschen, die man betreute, etwas zu teilen. Der christliche Auftrag des Mitarbeiters als Samariter erfüllte sich in Objekt-Beziehung zu den Bewohnern. Sie waren keine Subjekte, keine Individuen. Viele sind in dieser Haltung mitgeschwommen und haben dadurch das System mitgetragen und so dafür gesorgt, dass sie nicht auffielen. Wie angepasst man war, stellte man durch den regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes und der Andacht zum Wochenanfang unter Beweis.
Manches entwickelte sich in den 70ern auch anderes: Es gab einzelne Stationsleiter, die erste Ausflüge mit Bewohnern organisierten. 1977 sind die Mitarbeiter einer WG im Männerhaus erstmals zum Kleiderkauf mit den Bewohnern in die Stadt gefahren. Das war etwas ganz Besonderes und wurde vom Hausleiter nicht gern gesehen. Meist trugen die Bewohner Kleidung aus der Kleiderspende. Ob man mit neuen Ideen durchkam, hing von den Vorgesetzten ab. Im Haus Magdala habe ich mit den jungen Leuten Pizza gebacken, und wir haben zusammen meinen VW-Käfer angemalt. Das hat den Jungens Spaß gemacht. Im Bodelschwingh-Haus habe ich das Gegenteil erlebt. Ich hatte vom Stationsleiter den Auftrag erhalten, den Grießbrei für die Buben zuzubereiten. Weil ich statt Sirup eine Dose mit Früchtecocktail in den Brei getan hatte, fragte mich der Gruppenleiter, ob ich ein Weltverbesserer sei: „Na, du bist ja ein Revoluzzer, willst wohl alles ändern?“
Natürlich wollten einige von uns Jüngeren etwas verändern. So entwickelte sich ein regelmäßiges Treffen von studentischen Hilfskräften, Zivis, Gewerkschaftern und anderen kritischen Mitarbeitern. Wir trafen uns im Keller des Fliedner-Hauses und tauschten uns über die Missstände aus. Wir wurden immer mehr, und einige nutzten die Situation für ihre politischen Zwecke. Mitte der 70er-Jahre wurden dann auf einen Schlag eine ganze Reihe junger Mitarbeiter wegen „konspirativer Aktivitäten“ entlassen. In dieser Zeit entstand eine Initiative, die unter dem Titel „Mauern einreißen“ etwas für die Heime tun wollte. Wir planten ein Benefizkonzert. Auf dem Gelände wurde uns das verboten, deshalb fand das Multimedia-Fest in Darmstadt statt. Es kamen 3000 D-Mark zusammen, die wir direkt an das Haus Magdala spendeten. Dafür wurden wir vom Anstaltsleiter zur Rede gestellt. Ihm passte diese zweckgebundene Spende nicht, er wollte das Geld lieber für den großen Topf der Heime haben.
Wenn ich später zurückdachte, schämte ich mich dafür, dass ich anfangs so mitgelaufen bin. Ich habe mich bei den Menschen entschuldigt, denen gegenüber ich Fehler gemacht habe, und ich habe mich verändert. Denn nur wer sich ändert, kann etwas verändern.
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar zu dieser Seite
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
Jetzt Spenden
Menschen mit Behinderung brauchen Ihre Hilfe!
© Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie
Bodelschwinghweg 5 - 64367 Mühltal - Tel.: (06151) 149-0 - Fax: (06151) 144117 - E-Mail: info@nrd.de